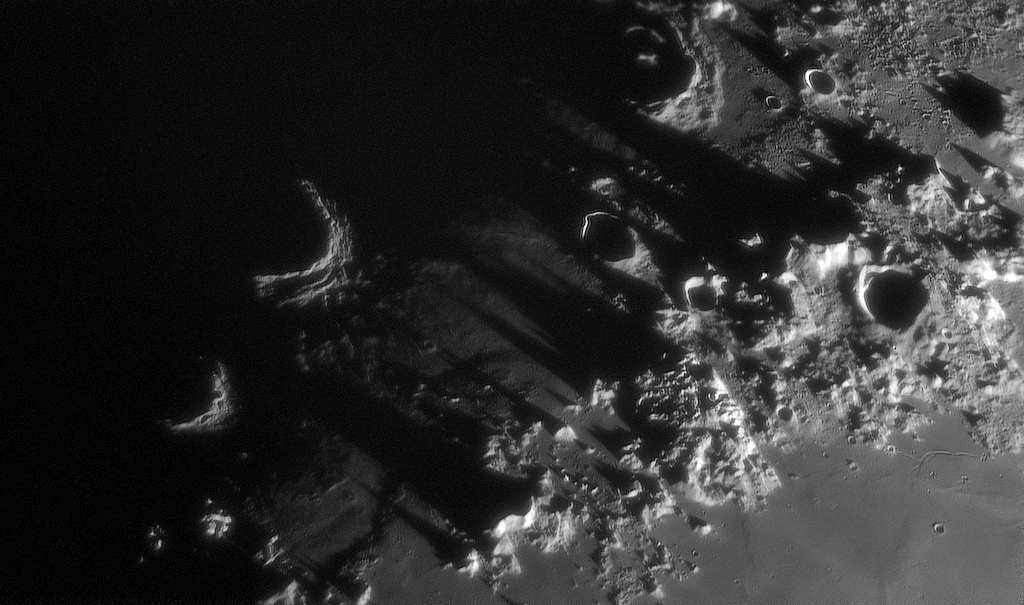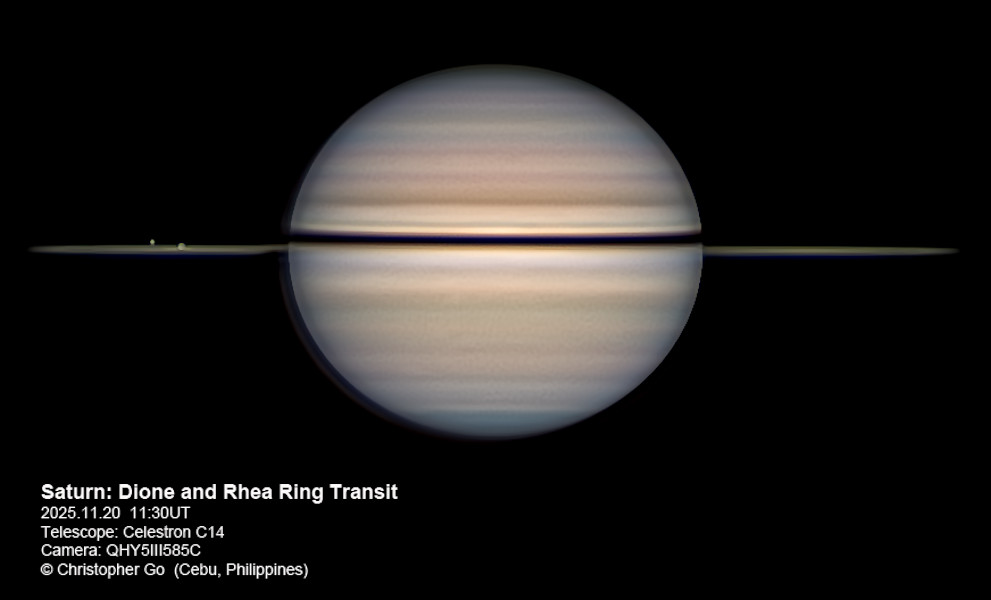Bildcredit und Bildrechte: Zhengjie Wu und Jeff Dai (TWAN)
Bei Vollmond ist der Mond am hellsten. Heute Nacht könnt ihr im Licht des ersten Vollmonds im Jahr 2026 stehen. Der Vollmondzeitpunkt ist am 3. Januar um 10:03 Uhr Weltzeit.
Etwa 7 Stunden später, um 17:16 Uhr Weltzeit, erreicht die Erde den sonnennächsten Punkt ihrer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne im Jahr 2026: das Perihel. Der Januar-Vollmond war auch nicht weit vom Punkt seiner größten Annäherung an die Erde entfernt, dem Perigäum. In diesem Mondphasenzyklus fand das Perigäum des Mondes am 1. Januar um 21:44 Uhr Weltzeit statt.
Ihr könnt auch den Planeten Jupiter sehen, der heute Nacht fast seine größte Helligkeit für 2026 erreicht. Er steht am Himmel nahe beim Vollmond. Vergesst aber nicht, nach den seltenen, hellen Feuerkugeln des Sternschnuppenstroms der Quadrantiden Ausschau zu halten, wenn ihr draußen den Nachthimmel beobachtet!