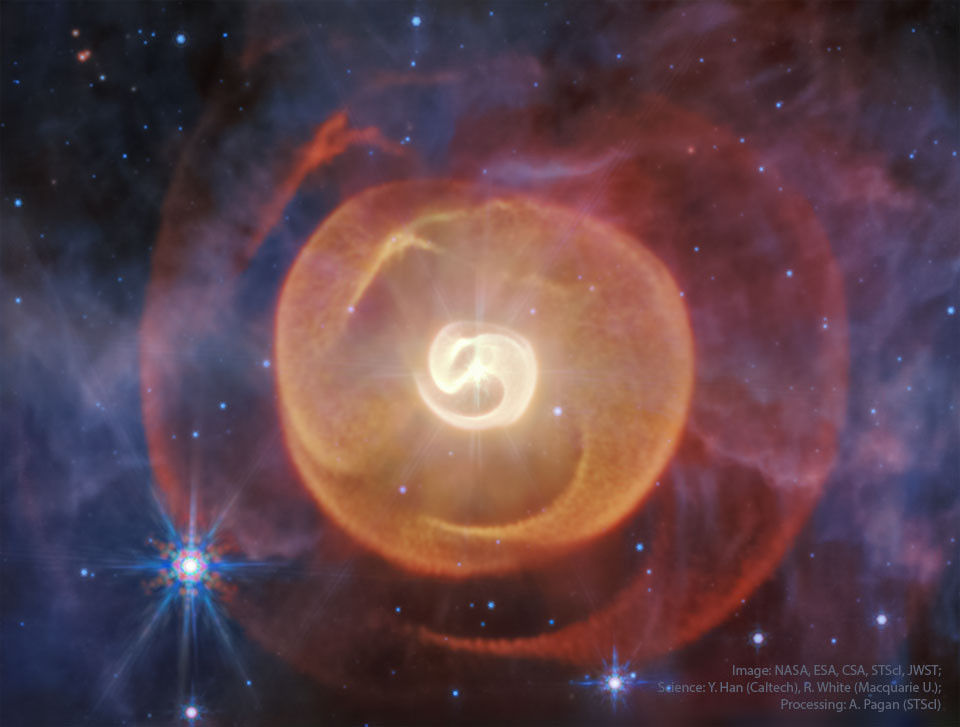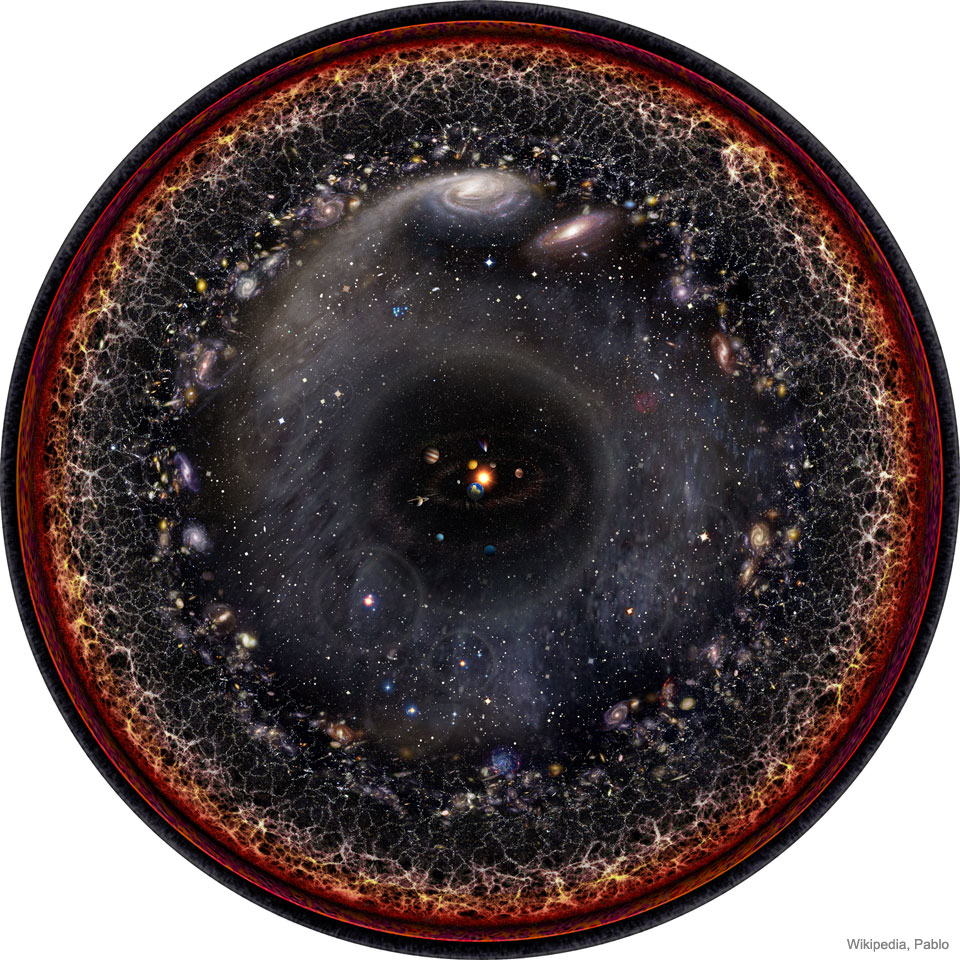Bildcredit: ESA, NASA, JPL, U. Arizona, Landesonde Huygens
Was würde man sehen, wenn man auf Titan stehen könnte? Dieses Farbbild zeigt die Ansicht einer fremdartigen, weit entfernten Landschaft auf Saturns größtem Mond Titan. Im Jahr 2005 nahm die ESA-Sonde Huygens diese Szene auf. Die Sonde sank damals 2,5 Stunden lang durch die dichte Atmosphäre aus Stickstoff, die mit Methan vermischt ist.
Die Felsen könnten aus gefrorenem Wasser und Kohlenwasserstoffen bestehen. Sie sind in unheimliches orangefarbenes Licht getaucht und liegen in der Szene verstreut. Die unwirtlichen Temperaturen betragen -179 °C. Der hellere Stein links unter der Mitte ist ungefähr 15 Zentimeter groß. Er ist 85 Zentimeter von der Kamera entfernt.
Man vermutet, dass die untertassenförmige Raumsonde etwa 15 Zentimeter tief in die Oberfläche von Titan eindrang. Demnach hätte er etwa die Beschaffenheit von nassem Sand oder Lehm.
Die Batterie der Huygens-Sonde machte es möglich, dass etwas mehr als 90 Minuten nach der Landung Daten aufgenommen und gesendet wurden. Die bizarre chemische Umgebung von Titan könnte der Erde ähnlich sein, bevor darauf Leben entstand.